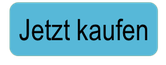5. Mai 12:27
Kreischend rannte das Mädchen durchs Unterholz. Es war blond, bleich und barfuß. Mit einem Stakkato hackten die mageren Beine durchs Gebüsch. Ihre langen Haare flatterten hinter ihr her wie die zerrissene Flagge eines flüchtenden Fähnrichs. Haken schlagend wich das leicht bekleidete Mädchen Felsblöcken aus und erreichte den alten Betondamm am Flussufer mit den verrosteten Armierungseisen.
Das Mädchen sah sich kurz nach der Horde um und sprang dann mit einem großen Satz ins kalte Wasser. Schreiend und mit weit aufgerissenen Augen verschwand es in einem Bombenkrater aus weißer Gischt. Als sich die Verfolger hinter ihr ins Wasser stürzten, zerrissen archaische Schreie die friedliche Auenlandschaft.
Das Wasser verschluckte sie.
Zum Zaudern war keine Zeit.
Ohne zu zögern, sprang Winter ins Wasser, das sich über ihm schloss. Er tauchte ab. Dann kam der Kälteschock. Mit dem Frühling hatte in den Bergen die Schneeschmelze begonnen und den Fluss mit frischem, eiskaltem Wasser anschwellen lassen. Die Kraft der Sonne reichte noch nicht, um das Wasser der Aare aufzuwärmen.
Unter Wasser öffnete Winter die Augen. Wo war das bleiche Mädchen? Über dem steinigen Flussgrund schlängelten Algen. Die spitzen Fangarme eines versunkenen Wurzelstocks reckten nach ihm. Er stieß sich mit der Hand ab und machte einige Schwimmzüge, die nach und nach die Kälte aus seinen Gliedern trieben. Die Strömung der Aare zog ihn unerbittlich mit. Das Wasser schimmerte grünlich.
Prustend tauchte Winter auf, schauderte und blinzelte sich das Wasser aus den Augen. Er atmete tief ein und schwamm mit ein paar kräftigen Zügen in die Mitte des Flusses. Die Wasseroberfläche glitzerte und funkelte in der Sonne. Knospende
Buchen säumten die Aare. Ein gebeugter Mann mit schlaffer Hundeleine stand teilnahmslos am Ufer.
Vor sich sah er einige Köpfe im Wasser. Das Mädchen im Bikini trieb im Rudel seiner Verehrer mit der Strömung gegen Bern, wo das Schwimmen in der Aare Volkssport war. Das schöne Wetter hatte sie wie Winter angelockt, der heute Morgen die Badehosen ausgegraben hatte, um sich ein erstes Mal im Jahr in die Aare zu stürzen.
Aber das Wasser war eindeutig noch zu frisch dafür. Jedenfalls hatte sich der Übermut der Jugendlichen vor ihm merklich abgekühlt. Die Schreie und das Gekreische der Clique waren verstummt. Nur ab und zu spritzten die kleinen Fontänen eines Beinschlages oder eines Neckens. Ansonsten war es ein friedlicher Mittag ohne Gummibote und Gedränge.
Winter zog an einem Wellenreiter vorbei, der an einem langen, elastischen Seil hing, mit seinem Brett für ein paar Sekunden gegen die Strömung ritt und dann im Wasser versank. Er und seine johlenden Kollegen trugen Neoprenanzüge.
Vernünftig.
Zur rechten Seite verwuchs der Gitterzaun der russischen Botschaft mit den Bäumen. Ein Eindringling konnte sich hier an den Ästen hinaufangeln und den Stacheldraht dort oben überwinden. Nicht besonders effektiv. Die Russen vernachlässigten die Wartung, verließen sich auf Bewegungssensoren und Kameras im Garten oder auf seine alten Kollegen bei der Polizei. Die Gefährdungslage einer Botschaft im beschaulichen Bern war schließlich nicht mit Berlin, Paris oder gar Kabul zu vergleichen.
Winter konnte als ehemaliger Einsatzleiter der Polizeisondereinheit Enzian und heute als Sicherheitschef einer kleinen Privatbank auch beim Schwimmen in der Mittagspause nicht ganz abschalten. Konstante Wachsamkeit, dauernde Alarmbereitschaft waren ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Sozusagen eine Berufskrankheit.
Die Bank hatte neben dem Hauptsitz hier in Bern Filialen in Zürich, Genf und Lugano, aber auch in London, Hongkong, New York, Singapur und Dubai, überall dort, wo sich das Geld der Reichen und Superreichen wohlfühlte. Von Tobler, Gründer der Bank, hatte die Internationalisierung konsequent vorangetrieben. Der »Alte«, wie sein Chef hinter vorgehaltener Hand ehrfürchtig genannt wurde, hatte ihn letzthin mit einem neuen Kunstwort überrascht. Eine erfolgreiche Bank müsse »glocal« sein, global und lokal.
Beim Tierpark mit den streng riechenden Wildschweinen drehte sich Winter auf den Rücken, legte den Kopf in den Nacken, spreizte Arme und Beine und ließ sich treiben.
Toter Mann. Tiefenentspannt. Wenigstens für einen Moment. Der blaue Himmel über ihm war wolkenlos, abgesehen vom Kondensstreifen eines vom nahen Flughafen gestarteten Flugzeuges. Am Ufer fügten sich die unzähligen Baumknospen zu einem riesigen, in unzähligen Grüntönen schimmernden Mosaik zusammen.
Der Geruch der Wildschweine verflüchtigte sich. Das Gehege mit den Pelikanen. Die gestutzten Flügel der verstümmelten Vogel stimmten
Winter jedes Mal traurig. Er war frei. Relativ. Er konnte machen, was er wollte. Oder wenigstens zu vielem Nein sagen. Meistens jedenfalls. Dieses Gefühl der Freiheit war ihm viel wert. Oder war es nur eine schöne Illusion, um das Leben erträglicher zu machen? Ein Betrunkener hatte ihm einmal erklärt, die Liebe sei nur ein Trick der Evolution, der das Überleben der Gattung sicherstelle. Gegen die Logik des Betrunkenen war er nicht angekommen, vor allem, weil dieser frisch geschieden war.
Doch was wusste er schon. Je älter er wurde, desto weniger.
Kindergeschrei. Das Geklimper des Gartenrestaurants. Lächelnd drehte sich Winter auf den Bauch und schwamm unter dem Schönau-Steg hindurch. In der Ferne wölbte sich die Kuppel des Bundeshauses, der frisch renovierte und mit viel Plattgold dekorierte Palast der Politiker in ihren Anzügen. Obwohl sie Management by Jeans machten: überall Nieten.
Das Parlamentsgebäude war nur einen Katzensprung von der Bank entfernt. Gut fürs Lobbying.
Aber zum Glück nicht sein Bier.
Er tauchte ab und schwamm unter Wasser gegen das linke Ufer, wich einem verrosteten, illegal entsorgten Fahrrad aus. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Winter fröstelte. Es war langsam Zeit, aus dem Wasser zu steigen.
Er tauchte auf.
In Ufernähe war die Strömung starker. Winter peilte die Ausstiegstreppe an, packte das Geländer und zog sich hoch. Der Trümmerbruch in seinem rechten Handgelenk war zum Glück einigermaßen verheilt und schmerzte nur noch bei großer Belastung. Im Judo musste er noch vorsichtig sein. Winter schüttelte sich, stieg schlotternd die Treppe empor und trabte über den Rasen des Marzilibades, das, abgesehen von einigen ledergegerbten, barbusigen Rentnern beiden Geschlechts, leer war.
Zehn Minuten später stieg Winter erfrischt und mit feuchtem Haar zur Bundesterrasse hinauf. In einem vegetarischen Take-away stellte er sich ein Mittagessen zusammen. Das Schlottern im kalten Wasser hatte seine Energiespeicher geleert. Ein paar schmale Gassen weiter erreichte Winter die Lauben, wo er neben seiner Lieblingspizzeria die schwere Eingangstür zur Bank öffnete. Daneben nur ein mattiertes Schild. Diskretion war auch in Zeiten des automatischen Informationsaustausches noch oberstes Gebot der Bank.
Im ersten Stock winkte er mit der Lunchbox der Empfangsdame hinter den Lilien zu und verschwand im für die Kunden nicht zugänglichen Teil der Bank. Die Tür zu Leonies fensterlosem, immer perfekt aufgeräumtem Kämmerchen stand offen. Leonie, seine rechte Hand, hämmerte konzentriert auf der Tastatur herum. An ihrem Bildschirm hatte sie einen Rückspiegel montiert, denn auch sie wusste gerne, was in ihrem toten Winkel geschah. Sie zwinkerte ihm zu. Winter ging weiter.
Manchmal war es besser, die Walliserin, die an TraktorPulling-Wettbewerben teilnahm und früher als Telematikerin für den einzigen Schweizer F1-Rennstall Motoren programmiert hatte, in Ruhe zu lassen. Manchmal war es besser, nicht zu wissen, wo im Netz sie sich gerade herumtrieb. Im Fall der Fälle konnte er so glaubwürdig behaupten, von nichts gewusst zu haben. Von Computern verstand Winter nicht allzu viel. Menschen waren ihm lieber. Obwohl er die auch nicht immer verstand.
In seinem Büro hängte er das Badetuch zum Trocknen über den Besucherstuhl und öffnete das Fenster in den Abluftschacht mit den röhrenden Rohren aus der Pizzeria. Das natürliche Licht blieb den Bankkunden vorbehalten. Mit dem Lunch sank er ins zerknautschte Ledersofa. Das Mobiltelefon pingte. Eine SMS von Leonie: »8ung! vT sucht dich ;-)«
Freiheit ist immer relativ. Zu »vT«, zu von Tobler, konnte er nicht Nein sagen. Das Mittagessen musste warten.